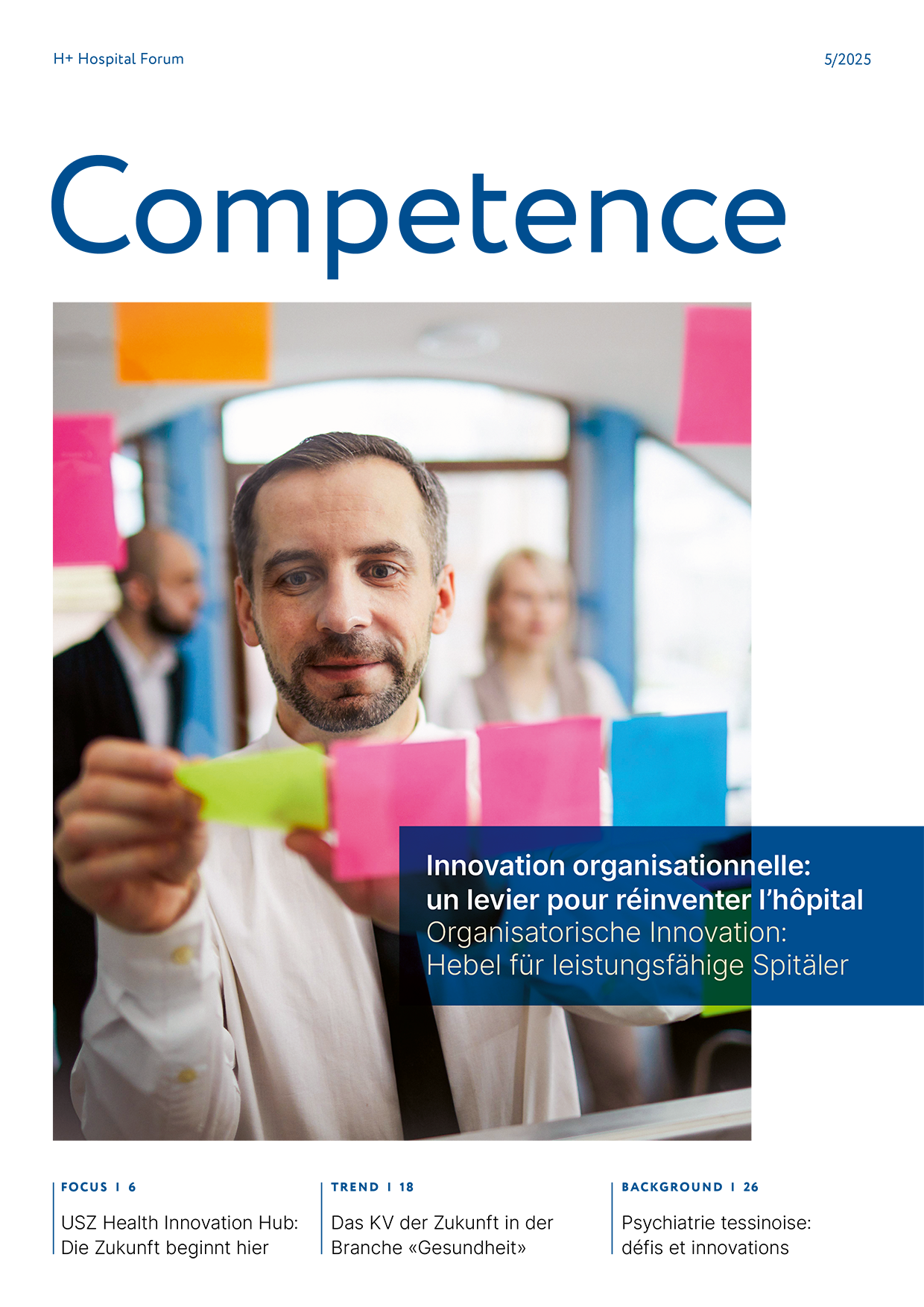3 min
3 minFOCUS
«Zeit ist in der Kindermedizin von immensem Wert»
Für eine qualitativ gute und vor allem kindgerechte Kindermedizin ist der Faktor Zeit zentral. Folgende konkrete Beispiele illustrieren das:
- Notfall: Mia ist 11 Monate alt und zu Hause unbeobachtet vom Sofa gefallen. Sie hat Schmerzen im linken Arm, wenn sie etwas greift. Die Ärztin auf dem Kindernotfall untersucht Mia, es lässt sich keine Fraktur ertasten. Sie nimmt sich Zeit, das Mädchen genau zu beobachten. Mia hat sich beruhigt und scheint die Arme normal zu bewegen. Als die Mutter Mia hochnimmt, fängt sie jedoch laut an zu schreien. Dies ist für die Ärztin ein Hinweis auf eine Schlüsselbeinfraktur. Ein Verdacht, der sich dann im Röntgenbild bestätigt. Beinahe wäre der Bruch unerkannt geblieben.
- Stationär: Luca ist ein Frühgeborenes und hat eine komplexe Organfehlbildung. Eine MRI-Untersuchung zur Abklärung kann bis zu 1,5 Stunden dauern und erfordert nicht nur die Anwesenheit einer Medizinisch-technischen Radiologieassistentin (MTRA), sondern auch einer Radiologin, weil die Qualität der Sequenzen während des MRI beurteilt werden muss. Zudem braucht es einen Arzt, da das Frühgeborene während des MRI händisch beatmet werden muss. Eine weitere Person führt ferner die notwendige Narkose durch.
- Ambulant: Sprechstunde in der Kardiologie des Spitals, wo der siebenjährige Nelio untersucht wird. Bei ihm besteht ein Vorhofseptumdefekt, zudem leidet er an einer Autismus-Spektrum-Störung. Selbst für eine einfache, schmerzfreie Untersuchung wie eine Echokardiografie braucht es viel Zeit für den Vertrauensaufbau, Erklärungen und Ablenkung. Während der Untersuchung ist eine Pause nötig. Manchmal funktioniert es auch gar nicht mit der Untersuchung, und es muss ein zweiter Anlauf unternommen werden.

Diese Beispiele zeigen, worauf es in der Kindermedizin besonders ankommt: Zeit. Dabei schlägt neben der Diagnostik und Therapie sowie der (Mit-)Betreuung des sozialen Umfeldes die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit bei den komplexen Krankheitsbildern zu Buche (siehe auch Interview mit Prof. Dr. med. Urs Frey, Ärztlicher Direktor UKBB).
In der Öffentlichkeit wird dieser erhöhte Zeitaufwand von allen Seiten anerkannt, aber in den realen Tarifen oft nicht ausreichend berücksichtigt. Dies auch deswegen, da in den Kinderspitälern die komplexen Fälle nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind.
Faktor Zeit im neuen ambulanten Tarifsystem besser berücksichtigen
Beim aktuell geltenden TARMED wurde der Aspekt Zeit nur ungenügend berücksichtigt. Die Kinderspitäler fordern nun, dass der Faktor Zeit im neuen ambulanten Tarifsystem bestehend aus TARDOC und ambulanten Pauschalen besser abgebildet wird. Ansonsten droht unsere heute noch hochstehende Kindermedizin zum Opfer einer verfehlten Tarifpolitik zu werden, weil der hohe Wert schlicht verkannt wird, den Zeit bei der Behandlung von Kindern hat.
Beitragsbild: UKBB