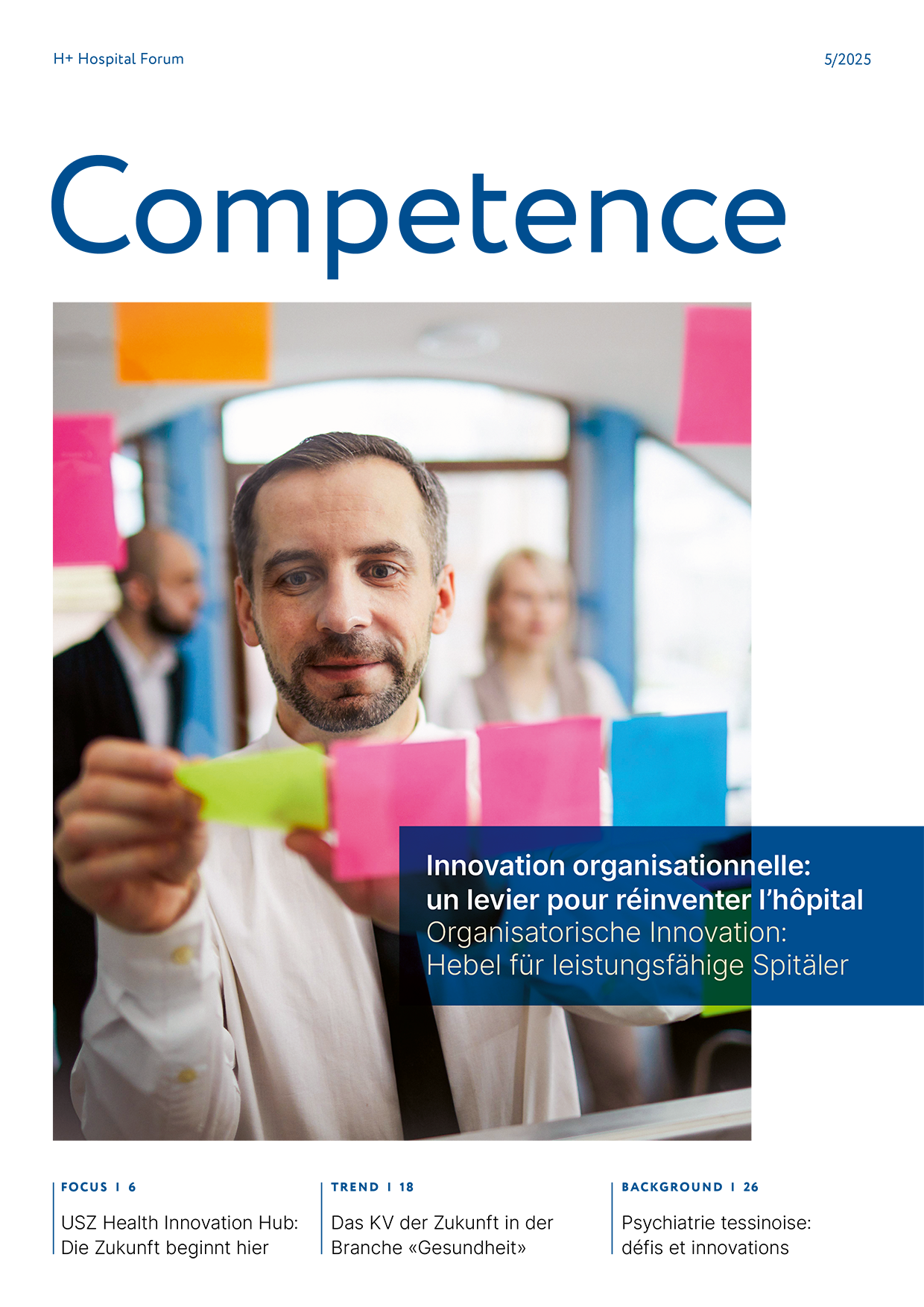4 min
4 minBackground
Medizin-ethische Richtlinien als Alltagshilfe
Frau Dr. Heise, die medizin-ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) entstehen in einem breit abgestützten Prozess. Welche Rolle spielen sie in ihrem Arbeitsalltag?

Von den aktuellen Richtlinien sind in meinem Fachgebiet als Intensivmedizinerin jene zu intensivmedizinischen Massnahmen, Reanimationsentscheidungen und zum Umgang mit Sterben und Tod massgebend. Sie spielen vor allem in Konfliktsituationen eine Rolle.
Und wie ist es in anderen Spitälern?
Ich stelle fest, dass die Gesundheitsfachpersonen und namentlich die Ärzt:innen sich auf jene Richtlinien konzentrieren, die ihr Fachgebiet betreffen – in grossen Kantons- und Universitätskliniken beispielsweise Organspenden. Die Richtlinien werden punktuell genutzt.
Welchen Nutzen bringt die Anwendung der Richtlinien?
Die Richtlinien zu intensivmedizinischen Massnahmen enthalten – wie die meisten Richtlinien – konkrete Handlungsempfehlungen. Beispielsweise wann ist es sinnvoll, Patient:innen auf der Intensivstation zu behandeln? Wie sollen die Patient:innen bzw. die Angehörigen einbezogen werden? Ist eine externe Ethikberatung sinnvoll? Sollte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) involviert werden? Es wäre schön, wenn das Wissen über die Richtlinien und über ihren Nutzen bei den Gesundheitsfachpersonen noch weiter verbreitet wäre.
Haben die Richtlinien während der Pandemie an Bekanntheit dazu gewonnen?
Dies war vor allem bei den Triage-Richtlinien der Fall, die Bestandteil der Richtlinien zu den intensivmedizinischen Massnahmen sind. Ich stelle heute aber fest, dass etliche Berufskolleg:innen zwar von den SAMW-Richtlinien gehört haben, diese aber nicht benennen können bzw. sie nicht in der Praxis anwenden.
Seit 50 Jahren: Orientierungshilfe im medizinischen Alltag
Die medizin-ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) sind breit anerkannt. Sie sensibilisieren Ärzt:innen und weitere Gesundheitsfachpersonen für ethisch herausfordernde Situationen und bieten seit über 50 Jahren Orientierung im medizinischen Alltag.
Die Erarbeitung der Richtlinien unter der Leitung der Zentralen Ethikkommission (ZEK) der SAMW folgt einem klar definierten Vorgehen. Dazu gehören Anhörungen von Expert:innen und eine öffentliche Vernehmlassung. Der durchdachte Prozess gewährleistet Transparenz, Qualität, Unabhängigkeit und eine breite Abstützung.
Die Richtlinien haben als berufsethische Normen auch eine rechtliche Bedeutung. So werden sie in der Regel in die Standesordnung der FMH aufgenommen und sind somit für deren Mitglieder verbindlich.

Sie können die Richtlinien in gedruckter Form in deutscher und französischer
Sprache kostenlos bestellen, auch in grösseren Mengen. In elektronischer Form sind sie zusätzlich in italienischer und englischer Übersetzung erhältlich.
Alle Richtlinien finden Sie unter: samw.ch/richtlinien
Welchen Nutzen bringt die Anwendung der Richtlinien für ein Spital und seine Mitarbeitenden?
Wenn die Richtlinien im Spital bekannt sind, können sie neben theoretischen Inputs konkrete Hilfestellungen für das Gesundheitspersonal bieten und Entscheidungen am Spitalbett auf eine breite Basis stellen. Dadurch steigt die Qualität der Entscheidungen. Die teilweise sehr konkret formulierten Richtlinien nehmen wichtige Themen auf und werden weitgehend in die Standesordnung der FMH aufgenommen.
Ist das Hauptziel der Richtlinien, dem Patientenwohl zu dienen?
Die Spitalleitungen und -mitarbeitenden würden das Patientenwohl stärker ins Zentrum rücken, wenn sie vermehrt die SAMW-Richtlinien zu Hilfe nähmen. Denn diese bringen eine breit abgestützte externe Sicht ein. Und sie helfen dabei, die subjektive Entscheidungsbasis auf eine objektive Ebene zu bringen – auch im Sinne der Spitalmitarbeitenden.
Wenn die Richtlinien im Spital bekannt sind, können sie neben theoretischen Inputs konkrete Hilfestellungen für das Gesundheitspersonal bieten.
Bitte nennen sie ein Beispiel.
Eine Pflegende, die acht Stunden am Bett im Einsatz ist, meldet einen ethischen Konflikt. Dieser wird von der Leitung aufgenommen und mit Hilfe einer massgebenden Richtlinie geprüft und im Team besprochen. Wenn dies systematisch so umgesetzt wird, bin ich davon überzeugt, dass sich die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden verbessert.
Mit Richtlinien alleine ist es aber nicht gemacht?
Nein, es braucht eine Kultur, die Diskussionen zu ethischen Fragen zulässt. Wenn ein Spital darauf verweisen kann, dass es ethische Fragen offen angeht, gewinnt es an Attraktivität. Je mehr (Be-)Handlungsmöglichkeiten wir künftig haben werden, desto wichtiger wird dieser Ansatz.
Wenn ein Spital darauf verweisen kann, dass es ethische Fragen offen angeht, gewinnt es an Attraktivität.
Wie verankern Sie neue Richtlinien in der Praxis?
Dies geschieht via ein Ethikgremium, in unserem Fall ist das die Ethikkommission. Via dieses Gremium kommunizieren wir neue Richtlinien. In der Kommission sitzen Kaderleute aus dem Pflegebereich, der Ärzteschaft, der Seelsorge und dem juristischen Bereich, welche die Informationen im Idealfall in ihre Teams weitertragen. Ich stelle aber fest, dass die Richtlinien auch bei uns noch zu wenig breit verankert sind.
Wie kann die Anwendung der SAMW-Richtlinien in Spitälern insbesondere gefördert werden?
Spital- und Klinikleitungen sollten Kenntnis von den Richtlinien haben, in ihren Bereichen über diese informieren und sie selbst auch anwenden. Das Vorleben und eine positive Haltung zu den Richtlinien hilft, dass Mitarbeitende unterer Hierarchiestufen sich trauen, Anliegen vorzubringen, weil sie wissen, dass sie ernst genommen werden. In Thun ist der CEO Mitglied der Ethikkommission. Es muss aber nicht unbedingt der CEO sein. Auch Vertreter:innen aus der Direktion oder Personen, die breite Akzeptanz geniessen, können einen Unterschied machen.
Beitragsbild: Interprofessionelles ethisches Gespräch auf der Intensivstation des Spitals Thun. (Foto: zvg)