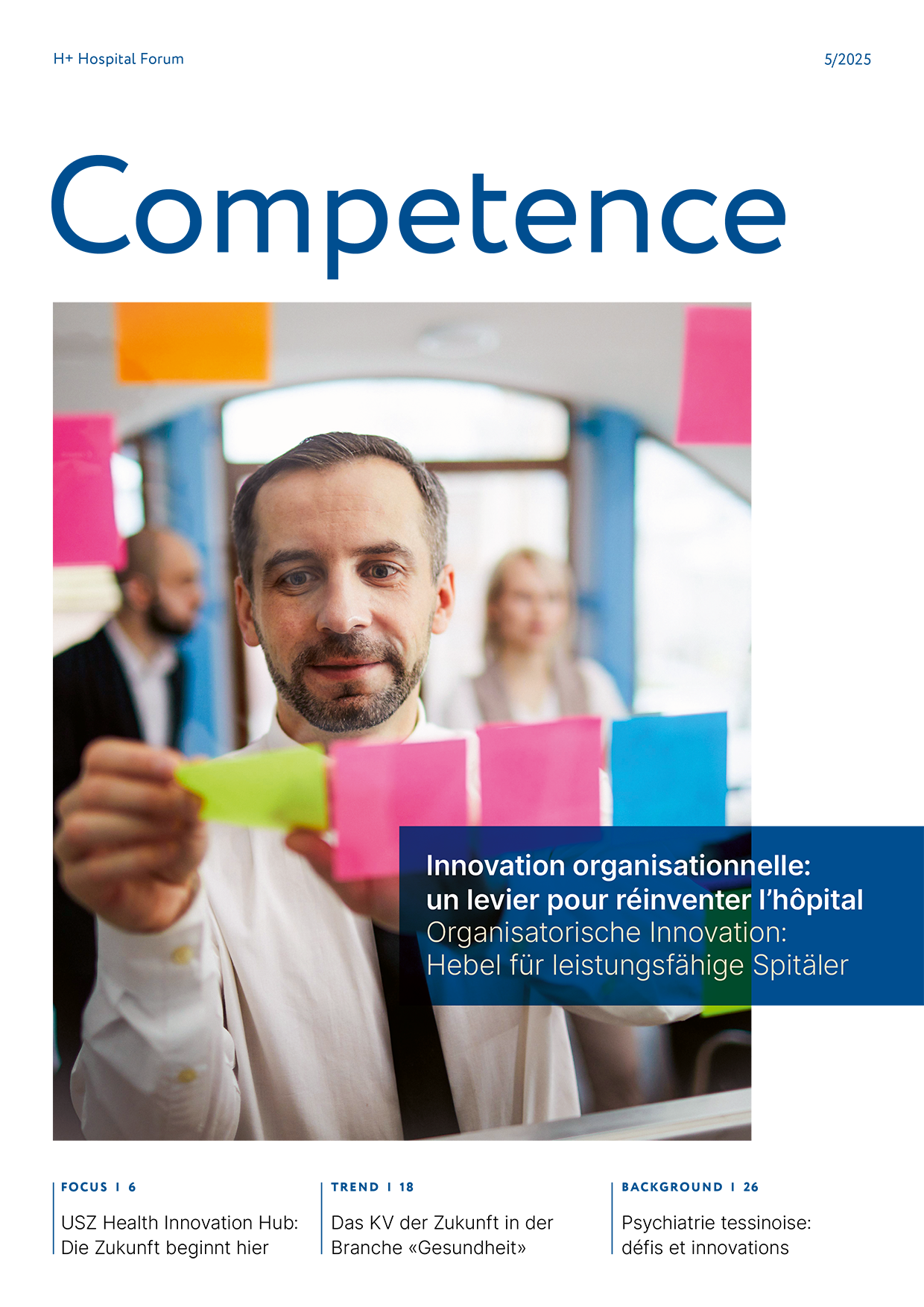5 min
5 minBackground
Damit Aggressionen und Gewalt gar nicht erst entstehen

Seit über zehn Jahren arbeiten die Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR) mit einem Fachkonzept zur Deeskalation von Aggression und Gewalt im Arbeitsalltag der Psychiatrie. «Es geht darum, Gewalt und Aggression zu verhindern, demnach präventiv dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst zu verbalen oder physischen Attacken gegenüber Mitarbeitenden kommt», sagt Andreas Werner-Reisdorf, Leiter Pflegeentwicklung bei den PDGR. Werner-Reisdorf betont die Wichtigkeit, dass diese Arbeiten auf einem fachlich fundierten Konzept basieren. Mitarbeitende werden ausgebildet, die im Arbeitsalltag gemäss diesem Konzept handeln.
Nachhaltige Gewaltprävention ist sehr ressourcenintensiv – aber sie lohnt sich für alle Beteiligten, Patient:innen wie auch Mitarbeitende.
Dies stammt vom Verein NAGS, einem Netzwerk zur Schulung und Entwicklung des Aggressionsmanagements im Gesundheits- und Sozialwesen der Schweiz und dem deutschen Institut ProDeMa (Professionelles DeseskalationsManagement). NAGS und ProDeMa bieten Kurse für Gesundheitsinstitutionen an und bilden Trainer:innen aus.
Mitarbeitende werden zu Präventions-Trainer:innen ausgebildet
«Wir bilden jene Mitarbeitenden zu Trainern aus, die auch wirklich Interesse daran haben, Deeskalationsmanager zu werden und sich mit den entsprechenden Themen auseinanderzusetzen», sagt Dr. med. Oliver Matthes, Chefarzt für das Zentrum für Krisenintervention und Psychotische Erkrankungen bei den PDGR.

Die Trainer:innen tragen die Inhalte aus den Ausbildungen weiter und schulen ihre Kolleg:innen in Sachen Gewalt- und Aggressionsprävention. Matthes ergänzt: «Wir brauchen eine Richtschnur und Leitbilder für die Mitarbeitenden, gemäss derer sie arbeiten und sich ausrichten können». Bei der Ausbildung zur Trainerin oder zum Trainer handelt es sich um keine Schnellbleiche, sondern um anspruchsvolle Ausbildungen, die anderthalb bis zwei Jahren dauern. «Sie werden zu Expert:innen ausgebildet. Das kostet Geld und braucht Zeit, aber dieser Weg wird sich für die Psychiatrie und die Notfallstationen langfristig auszahlen», sagt Werner-Reisdorf. Er meint damit beispielsweise, dass insbesondere auch Berufseinsteigende länger im Job bleiben, wenn die Vorgesetzten im Betrieb Aggressions- und Gewaltsituationen ernst nehmen.
Ereignisse werden erfasst, ausgewertet und daraus Anpassungen abgeleitet
Trainer:innen lernen beispielsweise, nicht nur heikle Situationen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf zu deeskalieren, sondern auch die zugrundeliegenden Ursachen von Aggressionen zu verstehen. Dabei hinterfragen sie, wie sie sowohl sich selbst als auch die Patient:innen schützen können – etwa durch eine gezielt deeskalierende Gesprächsführung, die auf die Bedürfnisse und Auslöser der Patient:innen eingeht.
Dabei spielt immer eine Rolle, ob es sich um Situationen auf einer Akutsituation oder in der Tagesklinik handelt. «Es braucht ein an die Bedürfnisse des Fachbereichs angepasstes Schulungskonzept. Allen Beteiligten muss aber immer klar sein: Gewalt wird in keiner Form toleriert, wir übernehmen als Vorgesetzte Verantwortung und stehen für unsere Mitarbeitenden ein. Einerseits müssen Aggressionsereignisse rapportiert werden, andererseits schaffen wir Gefässe, um intern über solche Situationen zu diskutieren. Wir gehen nach einem Ereignis proaktiv auf Mitarbeitende zu und fragen sie, wie es ihnen geht», sagt Pflegeleiter Andreas Werner-Reisdorf und ergänzt: «Es braucht von den Mitarbeitenden aber auch ein Verständnis für das Krankheitsbild, die individuelle Situation und die Bedürfnisse der Patientin, des Patienten.» Aggressionen können auftreten, da sie Teil bestimmter Krankheitsbilder oder Situationen sein können.
Für uns ist Prävention in Sachen Gewalt und Aggression genauso wichtig wie Schulung in lebensrettenden Sofortmassnahmen.
Andreas Werner-Reisdorf, Leiter Pflegeentwicklung, Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR)
Gemäss dem in den PDGR angewandten Konzept müssen Ereignisse nicht nur erfasst werden, sondern auch die jährliche Auswertung ist wichtig. Bei der Erfassung wird beispielsweise festgehalten, was passiert ist, in welchen Intervallen und in welcher Form die Aggression geschehen ist. Die Auswertung lässt Rückschlüsse und entsprechende Anpassungen zu.
Mitarbeitende lernen ausserdem, ihre eigene Stimmung bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren. Denn wenn sie angespannt oder gereizt sind, kann dies bei den Patient:innen ebenfalls Anspannung und Aggressionen auslösen. Sie erfahren, welche Worte und Verhaltensweisen in emotional aufgeladenen Situationen hilfreich sind und wie sie gezielt dazu beitragen können, Patient:innen zu beruhigen und Konflikte zu entschärfen. «Für uns ist Prävention in Sachen Gewalt und Aggression genauso wichtig wie Schulung in lebensrettenden Sofortmassnahmen», sagt Andreas Werner-Reisdorf. Oder anders: Gewalt und Aggression zu managen ist eine wichtige Kompetenz im Arbeitsalltag wie viele andere auch und gehört für Werner-Reisdorf zur fachlichen Weiterentwicklung.
Safewards-Konzept für Stationen
Dr. med. Oliver Matthes weist darauf hin, dass Gewalt im Gesundheitswesen immer in deren Kontext betrachtet werden muss: «Zwangsunterbringung ist für Patient:innen eine zutiefst belastende Erfahrung – auch wenn sie rechtlich begründet und medizinisch indiziert ist. Aus Sicht der Betroffenen bleibt es eine Form von Gewalt, die wir als Professionelle reflektieren müssen. Diese Spannung prägt unsere Arbeit täglich». Dasselbe gelte für Menschen, die auf den chronisch überfüllten Notfallstationen in Spitälern lange auf eine Behandlung warten müssen.
Wenn eine Station nur noch durch Kontrolle geprägt ist, kann das selbst Aggressionen erzeugen.
Dr. med. Oliver Matthes, Chefarzt Zentrum für Krisenintervention und Psychotische Erkrankungen, Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR)
Oliver Matthes weist auch darauf hin, wie wichtig die Atmosphäre auf psychiatrischen Stationen ist: «Wenn eine Station nur noch durch Kontrolle geprägt ist, kann das selbst Aggressionen erzeugen. Natürlich braucht es klare Strukturen und Regeln – aber gleichzeitig auch Räume der Begegnung. Entscheidend ist das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Nähe». Wichtig erscheint ihm darum beispielsweise, dass Pflegende für Patient:innen präsent und ansprechbar bleiben – nicht hinter Türen verschwinden. Diese Sichtbarkeit schafft Vertrauen und reduziert Eskalationspotenzial. Die PDGR arbeiten darum auch mit dem Safewards-Konzept, das darauf hinwirkt, Konflikte zu reduzieren und zu fragen, warum sie entstehen. Die Mitarbeitenden stellen sicher, dass Patient:innen jederzeit auf Gesprächsbereitschaft und ein offenes Ohr zählen können.
Sowohl Pflegeleiter Andreas Werner-Reisdorf als auch Dr. med. Oliver Matthes sind sich einig: «Nachhaltige Gewaltprävention ist sehr ressourcenintensiv – aber sie lohnt sich für alle Beteiligten.»
Beitragsbild: Canva