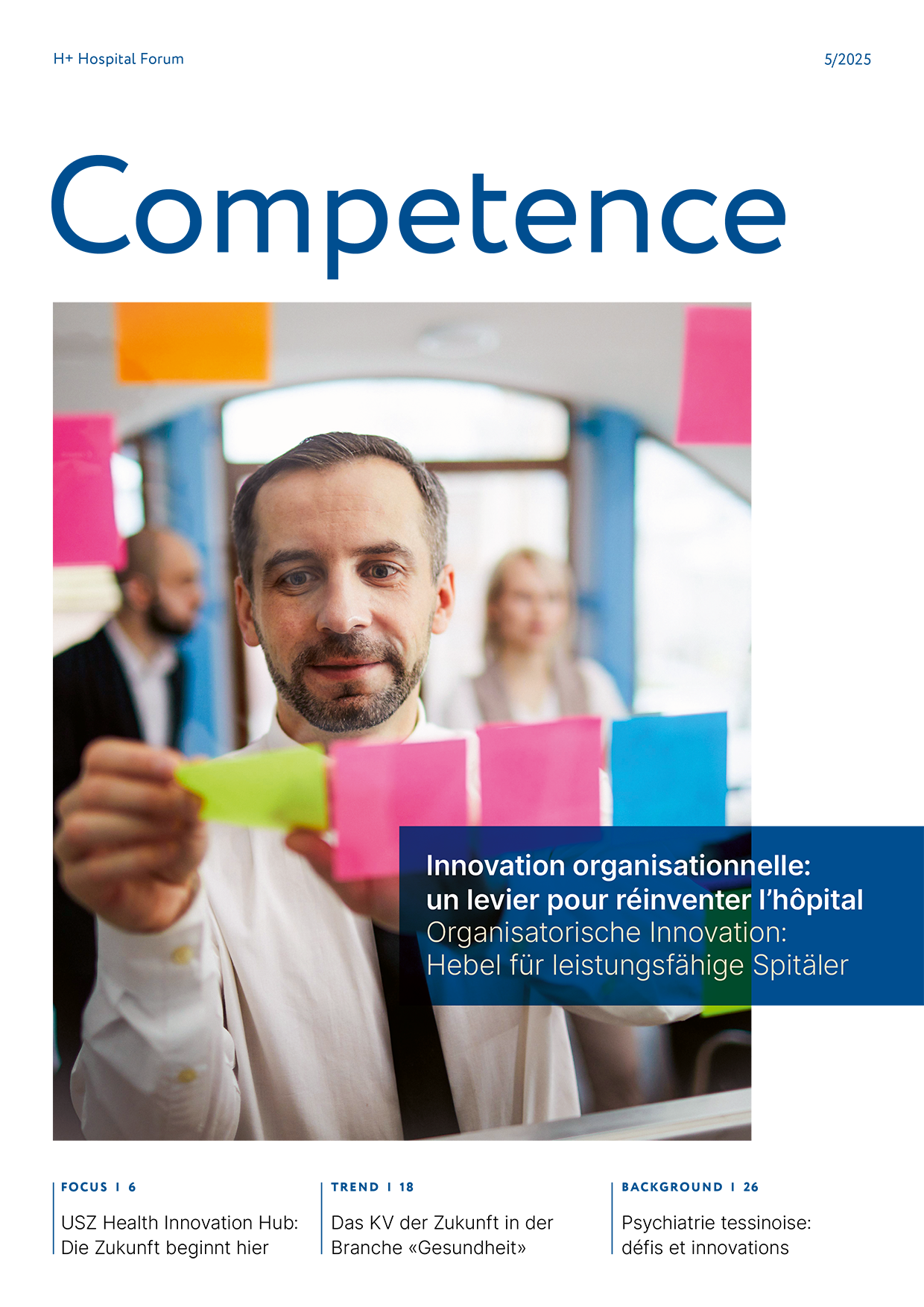8 min
8 minBackground
Psychiatrie im Tessin: Herausforderungen, Innovationen und Perspektiven
Frau Bohm, wie zeigt sich die aktuelle Krise in der Psychiatrie im Kanton Tessin? Gibt es lokale Besonderheiten, die die Situation beeinflussen?

Wir stellen eine konstant sehr hohe Auslastung der stationären Betten fest (durchschnittliche Auslastung 2025: 99,4%). Diese ist jedoch nicht ausschliesslich auf die Anzahl der Patient:innen zurückzuführen, die aufgrund eines klaren Bedarfs an stationärer psychiatrischer Behandlung eingewiesen werden. Häufig werden auch Menschen in die Psychiatrie eingewiesen, die eine geeignete Wohnform und eine bedarfsgerechte Betreuung benötigen – und für die es kein alternatives Angebot gibt.
Dabei denke ich beispielsweise an Personen mit verbalem oder physisch gewalttätigem sowie antisozialem Verhalten, die sich mitunter in einer Übergangsphase zwischen Strafverfahren und/oder Gefängnisaufenthalten befinden und für die es an adäquaten Einrichtungen mangelt. Ebenso betroffen sind Menschen mit gesicherter psychiatrischer Diagnose, die sich in einem stabilen Zustand befinden, jedoch über keine tragfähige Wohnsituation verfügen. Auch Personen ohne psychiatrische Behandlungsindikation, jedoch ohne festen Wohnsitz, die beispielsweise von der Polizei aufgegriffen werden, gehören zu dieser Gruppe – um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Menschen, die mangels Alternative bei uns hospitalisiert werden, besetzen dann die Betten, die dringend für Patient:innen, die sich in einer akuten psychischen Krise befinden, benötigt würden.
Häufig werden auch Menschen in die Psychiatrie eingewiesen, die eine geeignete Wohnform und eine bedarfsgerechte Betreuung benötigen – und für die es kein alternatives Angebot gibt.
Dieses Phänomen beobachten wir nicht nur im Tessin, sondern in der gesamten Schweiz. In Kombination mit der hohen Zahl an Zwangseinweisungen in unsere Klinik – bislang 400 im Jahr 2025, was 37,6 Prozent aller Eintritte entspricht – erhöht es den bereits bestehenden Druck auf unsere Einrichtung zusätzlich.
Ein weiterer Aspekt, der die Strukturierung unseres Angebots massgeblich beeinflusst, sind die geografischen Besonderheiten des Kantons mit seinen vielen grossen und kleinen Tälern sowie verstreuten Dörfern. Um das ambulante und tagesstationäre Angebot möglichst wohnortnah und flächendeckend zugänglich zu machen, betreiben wir insgesamt 16 Standorte, die über den gesamten Kanton verteilt sind.
Wie geht die OSC mit dem Personalmangel um? Haben Sie spezifische Massnahmen ergriffen, um Fachkräfte zu gewinnen oder zu halten?
Dies ist ein komplexes Problem für das es leider keine einfache Lösung gibt. In unserem Falle sind zudem die Rahmenbedingungen zu beachten; die Kantonale Soziopsychiatrische Organisation (OSC) gehört zur Kantonalen Administration, was den Handlungsspielraum betreffend Arbeitsbedingungen (Löhne, Ferien, Arbeitsstunden pro Woche, etc.) und Rekrutierungsprozess leider deutlich einschränkt.
Es muss Ziel sein, die bei uns ausgebildete Generation nach Abschluss der Ausbildung mit einer hohen Qualität der kontinuierlichen Weiterbildung im Haus zu halten.
Aber grundsätzlich denke ich, dass es das Ziel sein muss, die Generation die bei uns im Hause ausgebildet wird, nach Abschluss der Ausbildung zu halten. Ein zentrales Element dafür ist sicher eine hohe Qualität der kontinuierlichen Weiterbildung im Haus; oder die Möglichkeit, die wir in Zukunft vermehrt schaffen wollen, sich während einem Teil der Arbeitszeit auf ein gewisses Interessensthema zu fokussieren – sei es beispielsweise die Psychotraumatologie, die Psychoonkologie, andere spezifische Angebote oder ein Forschungsprojekt. Um die Aus- und Weiterbildung und die Forschung zu stärken, haben wir eine Vereinbarung mit der Università della Svizzera Italiana, Fakultät für Biomedizin, unterzeichnet.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie scheint in mehreren Kantonen besonders betroffen zu sein. Ist das auch im Tessin der Fall? Und wenn ja, welche Massnahmen konnten Sie ergreifen?
Auch wir verzeichnen eine deutlich steigende Nachfrage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Umso mehr freuen wir uns, im Dezember 2025 die neue «Unità di cura per minorenni» in San Pietro di Stabio einweihen zu können. Die OSC konnte bislang leider kein adäquates stationäres Angebot für Kinder und Jugendliche bereitstellen – unserer Klinik standen lediglich fünf Betten im Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) für die Betreuung junger Patient:innen mit psychischen Erkrankungen zur Verfügung. Die Eröffnung einer eigenen Station mit 13 Betten für diese Patientengruppe stellt daher einen wichtigen Meilenstein dar.
Im Rahmen der nächsten strategischen Planung ist zudem der Aufbau weiterer spezialisierter ambulanter Angebote für diese Altersgruppe vorgesehen. Geplant ist unter anderem eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit problematischem oder exzessivem Gebrauch von Videospielen, sozialen Medien, Smartphones oder Internetsucht – Phänomene, die zu sozialer Isolation, Depressionen und familiären Konflikten führen können.
Wie ist die Zusammenarbeit zwischen stationären und ambulanten Strukturen im Kanton organisiert? Funktioniert dieses Netzwerk gut, oder gibt es noch Spannungsfelder oder Verbesserungspotenzial?
Wie bereits erwähnt, betreibt die OSC 16 Standorte, an denen ambulante Leistungen oder tagesstationäre Angebote erbracht werden. Die Zusammenarbeit der stationären Abteilungen mit unseren, im gesamten Kantonsgebiet verteilten, ambulanten Diensten ist gut strukturiert und erfolgt unter anderem durch wöchentliche Koordinationssitzungen. Diese ermöglichen einen reibungslosen Informationsfluss zu den einzelnen Fällen und gewährleisten zugleich eine ebenso strukturierte Nachbetreuung der Patient:innen.
Wir legen besonderen Wert darauf, die Patient:innen rechtzeitig auf die Entlassungsphase vorzubereiten, da die ersten Wochen nach dem Klinikaustritt einen besonders sensiblen Abschnitt im Behandlungsverlauf darstellen.
Auch die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzt:innen funktioniert grundsätzlich sehr gut. Die Klinik der OSC, die Clinica psichiatrica cantonale, legt besonderen Wert darauf, die Patient:innen rechtzeitig auf die Entlassungsphase vorzubereiten, da die ersten zwei bis drei Wochen nach dem Klinikaustritt einen besonders sensiblen Abschnitt im Behandlungsverlauf darstellen. In enger Abstimmung mit den externen Fachärzt:innen werden ambulante Folgetermine vereinbart und die Weitergabe detaillierter klinischer Informationen sichergestellt. Darüber hinaus kann die OSC bei Bedarf eine multiprofessionelle Betreuung durch Fachpersonal organisieren, das die Patient:innen zu Hause betreut – bis die Betreuung durch den/die behandelnde:n Psychiater:in wieder vollständig sichergestellt ist.
Ist es möglich, interkantonale Projekte zu entwickeln? Oder verhindern die Besonderheiten des Tessins dies?
Es ist auf jeden Fall möglich, interkantonale Projekte zu entwickeln. Ein gutes Beispiel ist ein kürzlich umgesetztes Projekt mit dem Kanton Graubünden: gemeinsam haben wir eingeführt, dass sich unser Hometreatment-Team seit einigen Monaten auch um Patient:innen im italienischsprachigen Teil unseres Nachbarkantons kümmert.
Wir sind sehr daran interessiert und setzen alles daran, die Zusammenarbeit mit den Institutionen nördlich der Alpen aktiv zu pflegen und weiter zu stärken.
Natürlich stellen die Sprachbarriere und die geografische Distanz für andere Projekte eine gewisse Herausforderung dar. Dennoch sind wir sehr daran interessiert und setzen alles daran, die Zusammenarbeit mit den Institutionen nördlich der Alpen aktiv zu pflegen und weiter zu stärken. Die Herausforderungen sind letztendlich überall dieselben, und wir sind wie alle darauf angewiesen, von den Best practices, Erfahrungen, Benchmarks und Projektideen anderer Kliniken profitieren zu können.
Wie sehen Sie die Entwicklung der Rolle der OSC in den kommenden Jahren? Gibt es laufende oder geplante Projekte?
Ich glaube, die grundsätzliche Rolle der öffentlichen Psychiatrie bzw. der Kantonalen Soziopsychiatrischen Organisation (OSC) verändert sich nicht wesentlich. Unser Ziel ist es jedoch, der anhaltenden Tendenz zur Zentralisierung in stationären Einrichtungen aktiv entgegenzuwirken. Stattdessen möchten wir eine frühzeitige Erkennung, eine kontinuierliche Betreuung sowie eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung für Patient:innen in allen Lebensphasen fördern. Daher entwickeln wir unsere ambulanten, tagesstationären und Hometreatment-Angebote laufend weiter und passen sie gezielt an die Bedürfnisse der Bevölkerung an.
Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an zahlreichen Entwicklungsprojekten. So sind wir – um nur einige Beispiele zu nennen – dabei, unsere bauliche Infrastruktur zu erneuern, die Klinik organisatorisch neu auszurichten, die technische Infrastruktur von Grund auf zu überdenken und vieles mehr. Ziel all dieser Vorhaben ist es, die Qualität unserer Leistungen im Sinne unserer Patient:innen sowie die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern.
Beitragsbild: Canva